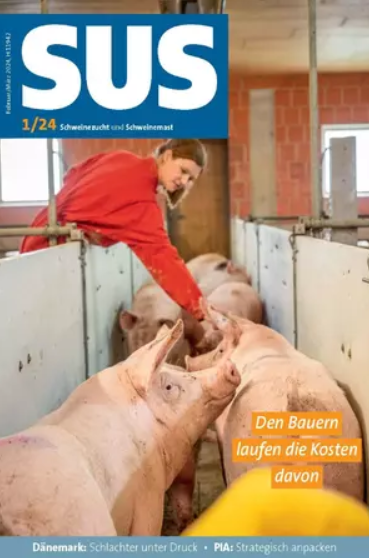BRS News
Blauer Zitzenversiegler von Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim hat seinen internen Zitzenversieglers jetzt weiterentwickelt. Der nun mit blauer Lebensmittelfarbe versehene Versiegler soll laut dem Unternehmen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit in der Anwendung sorgen. In Kombination mit dem beiliegenden großen Hygienetuch, der flexiblen Spitze sowie dem ergonomischen Stempel sollen außerdem der hygienischen und schonenden Applikation sowie der Arbeitsqualität Rechnung getragen werden. Reste der Versieglermasse sollen so beim Ausmelken besser erkannt und somit sicher von der Milch oder Mastitisflocken unterschieden werden. Der Zitzenversiegler ist für Rinder (Milchkühe) zur intramammären Anwendung zum Zeitpunkt des Trockenstellens zugelassen, mit null Tagen Wartezeit auf essbare Gewebe und Milch.
Online-Seminar der LWK Niedersachsen zur Weidehaltung
Im Rahmen des Netzwerks Fokus Tierwohl, einem Verbundprojekt, das den Wissenstransfer in die Praxis verbessern soll, um schweine-, geflügel- und rinderhaltende Betriebe in Deutschland hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen, führt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein kostenfreies, dreiteiliges Online Seminar zur Weidehaltung durch. Der 1. Teil, der am 25.02.2021 14:00 - 15:30 Uhr stattfinden wird, beschäftigt sich mit Grünlandmanagement in Hinblick auf Parasiten. Die Termine für die beiden Folgetermine im März und April werden noch bekanntgegeben.
Fördergeld effektiv nutzen
Die Landwirte stehen vor riesigen finanziellen Hürden. Gerade in der Krise gilt es, Fördermittel effektiv zu nutzen. Diese werden in der SuS aufgezeigt.
Die neue Pauschalierungsgrenze
Ab 2022 können nur noch Betriebe mit weniger als 600 000 € Umsatz pro Jahr pauschalieren. Entscheidend ist jeweils der Vorjahresumsatz.
Großbritannien beantragt Beitritt zu Pazifik-Freihandelsbündnis
Die neuseeländische Rotfleischindustrie freut sich über die Entscheidung Großbritanniens, sich für das transpazifische Handelsabkommen CPTPP zu bewerben. Jedoch müsse hierbei die Bereitschaft für höhere Standards berücksichtigt werden. Wir erwarten, dass Großbritannien die gleichen ehrgeizigen Ergebnisse in unseren bilateralen Verhandlungen zum Freihandelsabkommen erzielt
, sagt Sirma Karapeeva, Geschäftsführerin der Meat Industry Association in Neuseeland. Die besorgniserregenden Signale, die seit 2020 vom britischen Lebensmittelmarkt ausgehen, betreffen die Absenkung der Standards für Lebensmittelsicherheit. Großbritannien führt derzeit auch mit den USA Gespräche über ein Freihandelsabkommen.
Neue vorgeschlagene EU-Regeln könnten Folgen für vegane Lebensmittelunternehmen haben
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2017 hatte es den Herstellern veganer Lebensmittel in der EU bereits verboten, Begriffe wie Hafermilch
und Sojajoghurt
auf Verpackungen zu verwenden. Mit dem Ziel, die Bezeichnungen für Alternativen zu Milcherzeugnissen weiter einzuschränken, stimmte die EU Ende 2020 für einen Änderungsantrag. Er benötigt nun die Zustimmung des EU-Ministerrats. Der Änderungsantrag 171 zielt darauf ab, bestehende Beschränkungen rund um die Verwendung von Begriffen, die auf Milch Bezug nehmen, bei der Beschreibung oder Verpackung von pflanzlichen Lebensmitteln noch zu erweitern. Darunter fallen Ausdrücke wie enthält keine Milch
oder die Beschreibung der Eigenschaften eines pflanzlichen Lebensmittels, beispielsweise Formulierungen wie wie Milch
, sahnige Konsistenz
oder wie Butter
. Der Vergleich des CO2-Fußabdrucks eines pflanzenbasierten Lebensmittels mit seinem tierischen Pendant wäre ebenfalls unzulässig. Ebenso die Verwendung von Bildmaterial, das mit Kuhmilchprodukten verwechselt werden könnte – zum Beispiel aufgeschlagener weißer Schaum. Hersteller könnten auch keine Verpackungsdesigns verwenden, die an Milchprodukte erinnern, wie Joghurtbecher oder Milchtüten. Die Milchindustrie, die sich für den Änderungsantrag eingesetzt hat, argumentiert, dass das Verbot der Verwendung von milchbezogenen Begriffen notwendig ist, damit Verbraucher nicht in die Irre geführt werden.
Horizon2020 - Smart Agri Hubs: Termin für neue Projektvorschläge endet am 17.02.2020
Nächster Termin für Einreichung von Vorschlägen für SmartAgriHubs ist der 17. Februar. Ziel ist es, das bestehende SmartAgriHubs-Netzwerk um zusätzliche Interessengruppen und die Förderung der Durchführung von Innovationsexperimenten zu fördern. Die Zusammenarbeit mit neuen und bestehenden Digital Innovation Hubs (DIHs) und Kompetenzzentren (CCs) soll zu einer gemeinsamen Anstrengung einer aktiven und dynamischen Community führen, die Wissen und praktische Erfahrungen schafft, die letztendlich digitale Innovationen im Bereich der Lebensmittelindustrie fördern und verbreiten.
Wenn Sie Fragen zum Open Call haben, erstellen Sie bitte ein neues Thema in der Kategorie Open Call des Forums. Informationen finden Sie auch in diesem Web-Seminar.
Das Leuchtturmprojekt in Deutschland ist das FIE SmartPigHealth (SPH) im Regional Cluster North-West Europe.
Nutztiere sind ein unverzichtbares Element der agrarischen Bioökonomie

Nur ein kleiner Teil (ca. 10 bis 20 %) der pflanzlichen agrarischen Biomasse ist für den menschlichen Verzehr geeignet. Hauptgrund ist, dass der überwiegende Anteil der agrarischen Biomasse vom Menschen grundsätzlich nicht essbar ist, wie etwa Biomasse aus Grünland oder aus Zwischenkulturen. Sie stellt einen unvermeidlichen Bestandteil der gesamten agrarischen Erzeugung von Biomasse dar, denn der nachhaltige Anbau von lebensmittelliefernden Pflanzen erzwingt eine Fruchtfolge, die auch nicht essbare Zwischenkulturen enthält. Umso erstaunlicher ist es, dass die Bearbeitung des Futterwerts dieser Biomasse durch die Pflanzenzüchtung bislang kaum Beachtung findet. Darauf machen Prof. Wilhelm Windisch und Prof. Gerhard Flachowsky in dem Fachbeitrag Tierbasierte Bioökonomie
aufmerksam, der soeben in Kapitel 5 des Buches Das System Bioökonomie
erschienen ist. Nutztiere sind demnach ein unverzichtbares Element der agrarischen Bioökonomie, indem sie nicht essbare Biomasse in hochwertige Lebensmittel transformieren und einen Großteil der darin enthaltenen Pflanzennährstoffe über Wirtschaftsdünger dem agrarischen Stoffkreislauf wieder zurückführen.
Was die Schweinepest mit der Milchindustrie zu tun hat
Da die Verwertung hochwertiger Nebenprodukte der Milchindustrie in der Schweinemast eine entscheidende Verwertungssäule für die Milchanlieferung darstellt, ergäbe sich aus einer Reduzierung der Hausschweinebestände aufgrund der Afrikanischen Schweinepest eine direkte Konsequenz auf die Milchproduktion. Darauf hat der Geschäftsführender Vorstand der BMI in Landshut, Winfried Meier, im Gespräch mit der Politik aufmerksam gemacht, schreibt das BayerischeLandwirtschaftliche Wochenblatt.
Spermiendefekt bei Ebern beruht auf ungewöhnlicher Mutation
Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) haben eine Genmutation gefunden, welche die Spermien von Ebern verkümmern lässt. Bei Routinescreenings von Ejakulat wurden fünf Zuchteber der Rasse «Schweizer Edelschwein» auffällig. Das von ihnen gewonnene Sperma war unbrauchbar. Unter dem Mikroskop erkannten Tiermediziner, dass die Spermien nicht mobil waren, weil die Spermienschwänze verkürzt und gekrümmt waren. Die Forscher bestimmten das gesamte Erbgut der fünf Eber und verglichen dieses mit dem von gesunden Tieren. So konnten sie schließlich die Genmutation aufspüren, die dem Spermiendefekt zugrunde liegt.