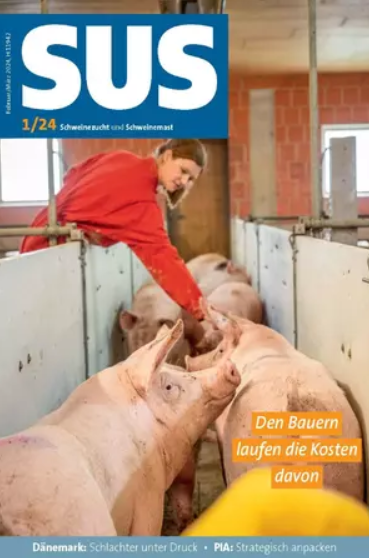BRS News Rind
Volkswirtschaftlicher Schaden durch Verbot der Neonikotinoide: 1,75 Mrd. Euro
Die drei neonikotinoiden Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam sind nur noch im Gewächshaus erlaubt.Unter Fachleuten ist das Verbot umstritten. Die Bundesregierung will auch nichts zu den volkswirtschaftlichen Folgen sagen. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen (Drucksache 19/678) hervor. Dabei gibt es dazu durchaus wissenschaftliche Untersuchungen, z.B. von der HFFA Research GmbH, die in dem GutachtenBanning neonicotinoids in the European Union - An ex-post assessment of economic and environmental costseine Prognose wagt. Die direkten Kosten werden auf rd. 1,75 Milliarden EUR geschätzt. Die Kosten ergeben sich u.a. aus niedrigeren Ernten, Produktionsverlagerungen (Eiweißimporten aus Brasilien), Wasserverlusten und höheren Treibhausgasen durch geänderte Anbautechniken. Diese werden auf 80 Millionen Tonnen C02-Äquivalente geschätzt. Das entspräche den jährlichen C02-Emissionen Australiens.
Düngeverordnung sorgt für Absatzeinbußen bei Kompost
Kompost wird ausBiomüllgewonnen und zur Bodenverbesserung gerne im Ackerbau eingesetzt. Durch die neue Düngeverordnung kommt es jedoch zu Absatzproblemen, die Kompostberge wachsen, informiert der NDR und beruft sich dabei auf Informationen der Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR). Als Grund werden Vorgaben der neuen Düngeverordnung genannt, die die Ausbringung organischer Dünger auf 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr beschränken. Warum soll man Geld für Kompost ausgeben, wenn man Wirtschaftsdünger aus dem Stall fast umsonst kriegen kann?
95 Euro pro Tonne Rapsstroh
Etliche deutsche Kraftwerke sind auf Rohstoffe aus der Landwirtschaft angewiesen. So hat das Bioenergiekraftwerk Emlichheim nach Recherchen des NDR einen Jahresbedarf von 75.000 Tonnen Stroh, die von rd. 300 Landwirten angeliefert werden. Aufgrund der Trockenheit und des steigenden Eigenbedarfs aufgrund neuer Tierhaltungsvorgaben droht dieser Rohstoff jedoch knapp zu werden, die Preise steigen. Je Tonne Rapsstroh bietet das Kraftwerk bis zu 95 Euro, auch für minderwertige Qualität.Hier geht es zur Ausschreibung.
Digitalisierung im Kuhstall: alles im Blick
Forum - Hans-Eggert Rohwer ist Milchbauer auf einem Hof in Schleswig-Holstein. Bei der Versorgung seiner 420 Kühe unterstützen ihn Hightech-Geräte und seine Erfahrung. Beim Wetter allerdings kann auch der moderne Landwirt nur abwarten und Milch trinken.Digitalisierung fördert Tierwohl
DLG - Tierwohl und Gesundheit der Nutztiere hängen unmittelbar zusammen. Tierwohl hat eine ethische Komponente, gefühlte Größen reichen aber nicht aus. Für die Gesundheit der Tiere bestehen klare Parameter. Der Erzeuger muss sie kennen, messen und bewerten. Und da kommt die Digitalisierung ins Spiel.Digitalisierung: Der Zukunft den Hof machen
Forum - Dem Landwirt Christoph Selhorst hilft eine App auf seinem Smartphone bei der Fütterung seiner Schweine. Auf dem Acker nutzt Phillip Krainbring Traktoren mit GPS zur präzisen Ausbringung von Dünger. Und Milchbauer Hans-Eggert Rohwer hat jede einzelne seiner 420 Kühe ganz genau im Blick – mithilfe von Sendern und Software. Moderne Landwirte setzen auf Digitalisierung – für mehr Tierwohl und Schonung der Umwelt.No risk, no farm!
DLG - Unternehmer gehen Risiken ein, können mit Ungewissheiten gut umgehen, sind leistungsbereit und entscheidungsfreudig. Erfolgreiche Unternehmer zeichnen sich zudem durch ein gesundes Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen aus. Die Junge DLG beschäftigt sich im Rahmen der diesjährigen DLG-Unternehmertage in Kassel unter dem ThemaNo risk, no farm!mit der Bereitschaft, Risiken als Grundlage für den Unternehmenserfolg einzugehen. Die Veranstaltung findet am Montag, dem 3. September 2018, um 16.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der Festsaal im Kongress Palais Kassel. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erwünscht. Sie kann online unter www.dlg.org/de/landwirtschaft/veranstaltungen/dlg-unternehmertage vorgenommen werden.
LKV-Bayern sucht Leiter/in des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung
Das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. (LKV) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zentrale in München einen Agrarwissenschaftler (Diplom/Master) (m/w) als Leiter des Sachgebietes Fleischleistungsprüfung in der Abteilung Programmierung und Datenverarbeitung (Vollzeit 40,1 Std/Woche). Als Aufgaben werden u.a. genannt:
- die Überprüfung und Sicherstellung der Datenqualität in der Leistungsprüfung
- die Auswertung der Daten zur Erstellung von Jahresabschlüssen für Betriebe und Fleischerzeugerringe
- statistische Auswertungen zu aktuellen Fragestellungen der Beratung
- die wissenschaftliche Interpretation der Ergebnisse, ihre Darlegung in Fachkreisen und Fachmedien
- die Konzeptionierung der Weiterentwicklung der bestehenden EDV-Programme für unsere Berater und Landwirte
- die Personalführung der Mitarbeiter des Sachgebietes FLP-EDV
- fachlicher Ansprechpartner für unsere Berater und Partnerorganisationen.
- abgeschlossenes Hochschulstudium der Landwirtschaft (Schwerpunkt Tierproduktion bevorzugt)
- Erfahrung in Personalführung
- sichere EDV-Kenntnisse zur Auswertung von Daten (z.B. SAS oder R), Datenbankkenntnisse sind von Vorteil
Trockensteherfütterung – wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben?
Proteinmarkt - B. sc. Merle Pahl und Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge von der FH Kiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich Agrarwirtschaft, Osterrönfeld befassen sich im aktuellen Beitrag mit der Frage: Wieviel fressen trockenstehende Kühe in Praxisbetrieben? Für die Fütterung in der Trockenstehzeit gilt die gleiche Regel wie für die Versorgung der Kühe während der Laktation: stets dem tatsächlichen Bedarf der Tiere entsprechend! Bedarfsempfehlungen gibt es hierfür. Die dann daraus abgeleiteten und publizierten Rationseckwerte basieren aber immer auf einer entsprechend angenommenen Futteraufnahmemenge dieser Tiere. Doch wie sieht es damit in der Praxis aus? Wieviel fressen die trockenstehenden Kühe? Wie groß sind die Unterschiede unter praktischen Gegebenheiten? Dieser Frage ging eine Erhebung in einigen Betrieben Schleswig-Holsteins nach. Den Fachartikel zu diesem Thema finden Sie hier.Kein Keimeintrag durch Geflügelkot
hib - Der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, bei denen multiresistente Keime durch die Ausbringung von Geflügelkot in Oberflächengewässer gelangt sind. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2874) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/2397). Die Grüne hatten darin den möglichen Eintrag in Oberflächengewässer von multiresistenten Keimen durch Mast- und Schlachtbetriebe thematisiert.